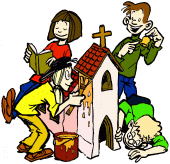 |
|
|
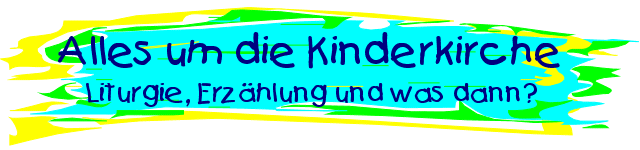
|
|||||||||||||||||||
Kindergottesdienst und GemeindeaufbauKindergottesdienst in den GemeindeaufbautheorienKindergottesdienst und Gemeindeaufbau - wie geht das zusammen?Wenn man in der gegenwärtigen Landschaft der Literatur nach entsprechenden Kapiteln sucht, könnte man den Eindruck gewinnen, der Kindergottesdienst kann nichts zum Gemeindeaufbau beitragen. Die jüngste Zielgruppe, die im Zusammenhang des Gemeindeaufbaus Beachtung findet, sind - soweit ich sehe - die Konfirmanden. Durch das Projekt KU 3+8 kommen allerdings jetzt erstmals zumindest auch die 9-Jährigen in den Blick, auch wenn man den Eindruck hat, dass in diesem Fall wiederum das Augenmerk besonders auf die Eltern gerichtet ist. Woran mag das liegen? Zwei Gründe scheinen mir dabei wesentlich zu sein.
Vieles wird also davon abhängig sein, wie Kirche mit Kindern vor Ort bewertet, wertgeschätzt und vorangetrieben wird. Werden die Kinder jedoch als ebenbürtige Adressaten des "Gehet hin ... und macht zu Jüngern" (Mt 28,19a) wie die Erwachsenen gesehen und wird die Verkündigung für sie ebenso hoch bewertet - und selbstverständlich in der Praxis auch Rechnung getragen - wie die für die Erwachsenen, dann ist damit schon ein wesentlicher Grundstein dafür gelegt, dass Gemeindeaufbau auch durch Kindergottesdienst geschehen kann.
Zum Gemeindeaufbau allgemeinZunächst gilt es, einiges Grundsätzliche über den Gemeindeaufbau, seine Herkunft, sein Gemeindeverständnis und seine grundsätzlichen Aufgaben darzustellen.Der Gemeindeaufbau geht letztendlich auf Jesus selbst zurück. Am besten lässt sich das am Missionsbefehl festmachen: Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker... (Mt 28,19). Gemeindeaufbau ist daher schon an sich missionarisch. Es geht um das weltweite Wachstum der Gemeinde, was selbstverständlich nicht anders geschehen kann, als im Wachstum jeder einzelnen Ortsgemeinde. Ja mehr, es geht dabei um das Individuum, das dem Jüngerkreis hinzugefügt werden soll. Aber nicht genug damit, diese getaufte Jüngerschar gilt es, weiter in der Lehre Jesu zu schulen. Es geht letztendlich darum, dass Menschen "zu einer persönlichen Christusbegegnung kommen" (M. Seitz) und dazu befähigt werden, dem Meister zu folgen. Aber wie macht man das? Dieser Frage wurde in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts besonderes Gewicht geschenkt. Einer der ersten, der hier Schritte für einen missionarischen Gemeindeaufbau veröffentlichte, war Theo Sorg. Seine Überlegungen resultierten nicht nur aus der Situation der Volkskirche, sondern waren auch getragen von einer Liebe zu dieser, die eben auch das ganze Volk erreichen will. "Leben aus der Mitte" war dabei sein Motto, der Gottesdienst das Zentrum des missionarischen Gemeindeaufbaus. Freilich ging er dabei von einem einladenden Gottesdienst aus, mit einer missionarischen Verkündigung, einer nachgehenden Seelsorge, einem Stab von geistlich motivierten Mitarbeitern und Kleingruppen in der Gemeinde, die nicht nur in die biblische Lehre solide einführen, sondern zugleich auch geistliches Leben praktizieren sollten. Dabei wurde deutlich: Gemeinde ist nicht einfach schon vorhanden - auch nicht in einer Volkskirche! Gemeinde ist - das liegt in der Natur des Sache - immer auf Wachstum ausgelegt! Und Gemeinde ist selbst noch in ihrem innersten Zirkel - wie auch immer der aussehen mag! - eines Wachstums bedürftig, also von einem guten zu einem besseren Glauben zu kommen. Und gerade auch das Umfeld der Volkskirche hat gezeigt: Es bröckelt an den Rändern, die Zahl derer, die sich wie auch immer zur Gemeinde halten, nimmt stetig ab. Seitz geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er selbst von einer Erosion in der Mitte ausgeht. Das hat aber katastrophale Konsequenzen, denn damit lässt die Anziehungskraft der Mitte nach, gerade diese missionarisch wichtige Mitte bleibt letztendlich ohne Wirkung nach außen. Gemeindewachstum hat folglich eine Innen- wie auch eine Außenperspektive. Betrachtet man schließlich die grundsätzlichen Aufgaben des Gemeindeaufbaus, dann gilt es dreierlei festzuhalten:
Gemeindeaufbau zielt auf ein intensives Wachstum, indem es von einer guten zu einer besseren Gemeinschaft der Heiligen führen will. Dabei gilt es besonders im volkskirchlichen Umfeld, die Getauften, aber dem Glauben entfremdeten, zum Glauben einzuladen. Und Gemeindeaufbau zielt auf ein extensives Wachstum als missionarische Aufgabe an den Ungetauften, insofern sie anstrebt, dass täglich Neue hinzugefügt werden (Apg 2,42) - ohne zu vergessen, dass nach wie vor der Herr das Subjekt des Gemeindeaufbaus ist. Es geht also darum, dem "Handeln Gottes dienstbar" zu sein. (Herbst) "Extensives und intensives Wachstum müssen einander entsprechen; keines für sich genommen genügt." (Herbst) Schließlich gilt es zu betonen, dass Gemeindeaufbau nicht als Programm zu verstehen ist, das durch die Not der schwindenden Mitgliederzahlen diktiert wird, sondern vielmehr als Gehorsam gegenüber dem Auftrag des Auferstandenen: Machet zu Jüngern! Was für den Gemeindeaufbau allgemein gilt, lässt sich durchaus auf das spezielle Feld Kindergottesdienst übertragen, zumal, wenn der Gemeindeaufbau aus der Mitte lebt, Gemeindeaufbau vom Kinder-Gottesdienst aus und auf ihn hin praktiziert wird! Und speziell eine Kirche, die für die Säuglingstaufe eintritt, steht in besonderer Pflicht, Gemeindeaufbau unter besonderer Berücksichtigung der Kinder zu betreiben. Winkler schreibt dazu: "Gemeindeaufbau wird zur notwendigen Konsequenz aus der Taufe und zum Kriterium für die Glaubwürdigkeit der Taufpraxis." Der Kindergottesdienst kann zwar nur Teil einer Gesamtkonzeption eines missionarischen Aufbaus sein, aber innerhalb dieser Gesamtkonzeption kann der Kindergottesdienst - als Gottesdienst der Kinder einer Gemeinde - durchaus seinen Teil für einen missionarischen Gemeindeaufbau übernehmen. Was es dabei zu beachten gilt, welche "Regeln" für ein planvolles Handeln dazu aufgestellt werden können, welche Chancen und Grenzen damit einhergehen, gilt es im Folgenden darzustellen.
Gemeindeaufbau durch KindergottesdienstVorbemerkungenWenn nun im Folgenden dargestellt wird, wie durch den Kindergottesdienst Gemeindeaufbau praktiziert werden kann, so ist immer zu beachten a) Der Geist schenkt den Glauben wo und wann er will (CA 5)! und b) Nie darf der spezielle und konkrete Kontext außer Acht gelassen werden: Der Ort, die Gemeinde, die Mitarbeitenden, die Kinder, die Räumlichkeiten, etc.Wie bereits beschrieben, hat Th. Sorg ein Konzept von missionarischem Gemeindeaufbau vom Gottesdienst her entwickelt. Sorg konkretisiert dieses Konzept an Hand von 7 Schlagwörtern. Ich möchte diese aufnehmen und auf die konkrete Situation des Kindergottesdienstes anwenden, nicht ohne dabei auch über die Vorschläge Sorgs hinauszugehen. Missionarischer GemeindeaufbauEinladender (Kinder-)GottesdienstEinladender Kindergottesdienst ist für mich zuallererst, wie Nipkow beschrieben hat: "Wenn er so lebendig gestaltet wird, mit Phantasie und Hingabe, daß sich dies herumspricht".Was aber heißt, lebendig, mit Phantasie und Hingabe gestalten? Diese Frage ist auch verknüpft mit der, was wohl ein Kind empfindet, wenn es das erste mal in den Kindergottesdienst kommt, aber auch mit der, was erwartet die, die regelmäßig kommen?
Missionarische VerkündigungIn der missionarischen Verkündigung geht es darum, "Alltagsnahrung für die Kinderseele" zu verteilen. "Das Kind soll das bekommen, was es für seine gegenwärtige Entwicklung bedarf, also nur Dinge, die es auch verdauen kann. Je besser die Nahrung, desto kräftiger das Wachstum, und je besser das Wachstum, um so grösser auch der Hunger." Dieses Zitat stammt nicht aus einer Werbung für Babynahrung, sondern aus einem Plädoyer für den Kindergottesdienst. (Jung) Dabei geht es um geistliches Wachstum und Entwicklung.Missionarische Verkündigung ist für mich zuerst auf das Alter der Kinder zurechtgeschnittene Verkündigung der frohen Botschaft, des Evangeliums! Weiter gehört für mich dazu, dass diese Verkündigung, wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, attraktiv und einladend ist. Bedenkt man den Entwicklungspsychologischen Unterschied der Dreijährigen zu den 13-Jährigen, dann kann missionarische Verkündigung nur in der Aufteilung der Kinder in mindestens drei, besser vier Altersgruppen stattfinden. In meiner vorigen Gemeinde haben wir die vier Altersgruppen praktiziert. Es waren genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie auch genügend Räume vorhanden. Zudem wurde auch die Liturgie in zwei Altersgruppen getrennt. Aus 30 Kindern wurden so binnen etwa 2 Jahren 80 Kinder! Aber auch das Gegenteil habe ich erlebt. Mangels Helfer werden die Kleingruppen reduziert. Besonders die Ältesten bleiben schneller weg, als man schauen kann! Im Zusammenhang der missionarischen Verkündigung gehört m. E. auch das Stichwort Elementarisierung und der in der Promise-Land-Arbeit von Willow-Creek immer wieder betonte Begriff der Relevanz! Die Kinder sollen erfahren, dass diese biblischen Geschichten, die sie hier hören, mit ihnen zu tun haben. Soweit es an uns liegt, müssen wir alles daran setzen, dass die Erzählung so sehr für sich "spricht", dass die Kinder in den Geschichten wie J.G. Hamann plötzlich entdecken: Das bin ja ich! Da geht es ja um mich! Und so schreibt O. Bayer: "Erzählte Geschichten bieten Identifikationsmöglichkeiten. Plötzlich sehe ich mich selbst in der erzählten Geschichte und höre sie als meine eigene Geschichte." Und an anderer Stelle: "Gott begegnet in Geschichten und legt den diese alten Geschichten Hörenden durch sie so aus, daß dieser verändert, ein neuer Mensch wird." Das ist missionarische Verkündigung! Dabei werden die einen Kinder viele Geschichten das erste Mal hören. Ihnen ist die Welt der Bibel z. T. fremd. Dies gilt es dann beim Erzählen angemessen zu berücksichtigen, so dass die Kinder in dieser Geschichte mitleben können - eine besondere Fähigkeit der Kinder! Auf der anderen Seite werden viele der Kindergottesdienstkinder die Geschichten schon kennen. Gerade die Älteren schalten dann gerne ab: Kenn' ich schon! Aber ihnen muss deutlich gemacht werden, da steckt auch für dich noch etwas "Neues" drin - quasi historisch und geistlich! -, denn darin gleichen die älteren Kinder allemal den Athenern (vgl. Apg 17,21). Als missionarische Verkündigung wird Kindergottesdienst zuallererst eine elementare Grundkenntnis an biblischen Geschichten zu vermitteln haben, darüber hinaus aber die Relevanz des Evangeliums den Kindern nahe zu bringen suchen, um sie auf den Weg des Glaubens zu führen. Und um diesen Weg mitgehen zu können, muss man ja wissen, auf was man sich da einlässt, das fordert die Redlichkeit! Deshalb ist es auch wichtig, dass der Text(-Themen)-Plan ein breites Spektrum der biblischen Texte abdeckt. Obendiek ist darin zu widersprechen, die Vorgaben dieser Texte als "tote Vorschrift eines Textplanes" zu bezeichnen im Gegensatz zu der von ihm vorgeschlagenen sozialpsychologischen Arbeit. Natürlich kann sich Kirche vor letzterer Aufgabe nicht verschließen, aber es gilt das Profil des Kindergottesdienstes als Gottesdienst am Sonntag immer wieder zu schärfen und hier auch das anzubieten, was mit diesem Markenzeichen versprochen wird: Gottesdienst mit Kindern! Dennoch würde ich gerade dafür plädieren, dass der Text-Themen-Plan speziell auch für die Sonntag für Sonntag angebotenen Kindergottesdienste mehr biblische Reihen anbietet. Wir haben sehr gute Erfahrungen in unseren Kindergottesdiensten gemacht, wenn wir über Wochen hinweg bei ein und derselben biblischen Gestalt geblieben sind. Gerade bei den Jüngsten haben wir sogar entdeckt, wie sie mit diesem" Glaubens-Vorbild" regelrecht zu leben beginnen und gespannt auf die Fortsetzung kaum den nächsten Kindergottesdienst abwarten können. Nach meiner Erfahrung bereitet es den Kindern dagegen sehr große Schwierigkeiten, wenn in thematischen Einheiten Geschichten aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen herausgerissen und neben andere aus anderen Kontexten gestellt werden, da sich die Kinder mehr mit einer Person als mit einem Thema identifizieren. Weiter sollte eine bessere Abstimmung mit den Pflichtthemen des RU - so weit dies möglich ist - erfolgen. Wie viele Geschichten wie die des Nehemia finden weder Eingang in den RU noch in den Kindergottesdienst? Missionarische Verkündigung kann auch insofern auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Ziel all dieser Unternehmungen wird dabei sein, wie Askani einst betonte, die Gelegenheit des Kindergottesdienstes wahrzunehmen, "beizeiten zu üben, im Namen Jesu zu leben." Nachgehende SeelsorgeFür die nachgehende Seelsorge ist zunächst einmal ein Vertrauensverhältnis zu den einzelnen Kindern nötig. Dieses Vertauensverhältnis kann aber nur durch die regelmäßige Anwesenheit des Helfers als auch des Kindes entstehen. Im Übrigen vermittelt ja der regelmäßig anwesende Helfer auch ohne Worte: der Kindergottesdienst ist eine tolle Sache und ich habe Interesse an ihm und an dir! Diese Regelmäßigkeit des einzelnen Helfers wird sich auch im Besuch der Kinder widerspiegeln. Auch der Kontakt zu dem es vor und nach dem Kindergottesdienst kommen kann, wird seinen Teil zu diesem Vertrauensverhältnis beitragen. Kinder spüren im Übrigen sehr schnell, ob ihnen ein offenes Herz entgegen tritt oder nicht. Da kann es sich dann völlig ungezwungen ergeben, dass Kinder anfangen, ihr Herz auszuschütten.Nachgehende Seelsorge kann u. U. schon im Gespräch in der Kleingruppe im Anschluss an die Verkündigung entstehen. Gut erzählte Geschichten können Fragen aufwerfen, die hier z. T. ihren Raum haben. Nachgehende Seelsorge heißt aber auch, dass Kinder, die nicht mehr in den Kindergottesdienst kommen, besucht werden oder zumindest eine kleine persönlich gestaltete Einladung im Briefkasten vorfinden. Die Kinder sollen erfahren: man registriert, dass ich nicht mehr komme, hier bin ich wichtig. Wichtig ist nur, dass hier kein auch nur scheinbarer Druck ausgeübt wird. Geistlich motivierte Mitarbeiter An den geistlich motivierten Mitarbeitern wird sich viel entscheiden. Sie zu machen ist unmöglich! Was jedoch im Rahmen des Machbaren liegt, soll hier kurz dargestellt werden.
HausgemeindenHausgemeinden sollen den Gottesdienst für Th. Sorg ergänzen, damit der Einzelne in persönlicher Atmosphäre seine Fragen und Nöte artikulieren kann. Wo im Kindergottesdienst noch in Kleingruppen aufgeteilt wird, die auch in der Art ihrer Aufteilung konstant bleiben, ist dieses Element bereits vorhanden. Nach meiner Erfahrung liegt die Obergrenze einer "guten" Kleingruppenarbeit bei etwa 10 Kindern. In diesem Rahmen sind noch einigermaßen persönliche Gespräche möglich und die Überschaubarkeit ist gewahrt. D. h., die Anzahl der Gruppen muss entsprechend der Kinderzahlen mitwachsen! Wieder ist auf die Promise-Land/Vaterhaus-Arbeit zu verweisen, die diesen Kleingruppen feste und regelmäßige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuordnet (vgl. die seelsorgerlichen Aspekte oben!). Auch ich habe damit sehr gute Erfahrungen in drei Gemeinden gemacht!In der Kleingruppe sollte im Kindergottesdienst Verkündigung geschehen und hier kann dann auch ein Austausch über den Glauben stattfinden. Die Kleingruppe ist auch der Ort, an dem die Mitarbeitenden ihren persönlichen Glauben bezeugen können, nach dem Motto: "Der Glaube ist immer persönlich - aber nie privat." (Krause) Denn durch dieses persönliche Zeugnis kann auch der Glaube der Kinder wachsen. Ein Aspekt Sorgs, der damit aber verloren geht, ist, dass das Treffen im Hauskreis, sozusagen dem Gottesdienst im Alltag Rechnung trägt. Dies kann eine "All-in-one" Veranstaltung nicht leisten - und braucht es auch nicht zu tun! Denn der Kindergottesdienst soll außerhalb des Sonntags durch andere kirchliche Veranstaltungen ergänzt werden. In vielen Gemeinden werden dies die Angebote der Jungscharen und, wo es sie gibt, der Kinderhauskreise ebenso sein, wie projektbezogene Angebote. Einführung in die biblische LehreDass die Einführung in die biblische Lehre zu den zentralen Aufgaben in der Verkündigung im Kindergottesdienst gehört, wurde schon in der missionarischen Verkündigung ausführlich dargelegt. Dass dies nicht im Sinne einer systematischen Lehrveranstaltung misszuverstehen ist, liegt nach den bisherigen Ausführungen hoffentlich auf der Hand. Einführung in die biblische Lehre heißt für mich, Sonntag für Sonntag biblische Geschichten spannend, ausdrucksstark und vielseitig zu erzählen.Angebote spirituellen LebensTh. Sorg will unter diesem Stichwort erreichen, dass Gruppen und Kreise neue Formen geistlichen Lebens quasi "erforschen" um sie dann im Teebeutel-Prinzip an die Gemeinde weiterzugeben. "Der Teebeutel vermittelt dem Wasser in der Kanne Geschmack, Farbe und Kraft. Durch die Poren des Teebeutels, das heißt einer verbindlichen Gruppe, gehen geistliche Einflüsse und missionarische Wirkungen auf die Umgebung aus. Sie gibt Anstöße, die verwandelnde Kraft haben können."Vielerorts wird immer wieder gefordert, dass der Gottesdienst und die Gemeinde sich gerade vom Kindergottesdienst her reformieren lassen sollen. Jüngst so wieder B. Schröder in seinem Referat: Was ist (uns) der Kindergottesdienst wert? So recht Schröder im Einzelnen mit seinen Forderungen auch haben mag, ich denke, dass das Teebeutel-Prinzip auch hier tatsächlich gelten sollte: Der Teebeutel hängt im Wasser und gibt Geschmack und Farbe quasi automatisch ab. Jedes Nachhelfen von außen um den Vorgang zu kürzen, schadet dem Aroma! Vielmehr stellt sich für mich die Frage, wie wir den Teebeutel Kindergottesdienst mit dem Wasser Gemeinde in Berührung bringen können, was dann auch entsprechende Veränderungen bewirken kann. An dieser Stelle geht es also auch um das Verknüpfen der Kindergottesdienstarbeit mit anderen Bereichen unserer Gemeindearbeit, so dass auch dadurch Gemeindeaufbau entsteht. So gestaltet unser Mitarbeiterteam mit anderen Gruppen der Gemeinde (Musik-, Theaterteam, ...) nicht nur ein Krippenspiel zu Weihnachten, sondern auch einen besonderen Gottesdienst an Ostermontag und Pfingstmontag, zudem nicht nur die Kinder der Kinderkirche und ihre Angehörigen herzlich willkommen sind. Findet ein Gottesdienst auf einem Bauernhof statt, bieten wir parallel dazu Kindergottesdienst im Heuschober an etc. Solche Angebote werden sehr gerne angenommen! Nicht zuletzt sollte es zu einem Zusammenspiel und gegenseitigem Ergänzen und Profitieren aller kommen, die in der kirchlichen Arbeit mit Kindern tätig sind. Vielleicht erwächst ja daraus die Einsicht, dass der Kindergottesdienst am Sonntag der "Gottesdienst der Kinder in der Gemeinde" (Walter) ist und als solcher auch Wert ist, gefeiert zu werden. Der Kindergottesdienst ist eben keine Konkurrenz zu den verschiedenen Angeboten unter der Woche! Die Erfahrungen aus dem Kindergottesdienst können durchaus auch Einfluss auf den Erwachsenengottesdienst, den Konfirmandenunterricht, usw. haben - und umgekehrt! So bringt A. Pohl zum Ausdruck, was auch meine Erfahrung ist: "Durch die Arbeit mit Kindern gewinnt die übrige Gemeindearbeit. Meine Beziehung zu Konfirmanden und Jugendlichen verändert sich, sie kann gelassener, spielerischer, verständnisvoller werden. Ich kann gute Erfahrungen einbringen in die Arbeit mit Erwachsenen, mit Presbytern, mit Alten. Zeit, die ich in den Kindergottesdienst investiere, ist gewonnene Zeit." Und das nicht zuletzt, weil wir dabei "lernen, die biblische Botschaft elementar zu verkündigen, das Evangelium so umzusprechen, daß es verstehbar, auch fühlbar und greifbar wird."
Neue Wege im Kindergottesdienst?Im Zuge einer ecclesia semper reformanda (stets zu reformierenden Kirche), gilt es auch den Kindergottesdienst immer wieder auf seine "Attraktivität" kritisch zu hinterfragen und den Bedürfnissen der Kinder im Rahmen der Evangeliumsverkündigung anzupassen. Aber grundsätzlich gilt hier dasselbe, was G. Ebeling für den Gottesdienst gesagt hat: "Wir müssen aufhören, uns des Reichtums zu schämen, der uns in Gestalt des [Kinder-] Gottesdienstes anvertraut ist. Der [Kinder-] Gottesdienstbesuch mag noch so gering sein. Wir sollten davon ausgehen, dass schon das Angebot eines [Kinder-] Gottesdienstes ein in unserer Welt sich ganz und gar nicht von selbst verstehender Reichtum ist."Wir müssen uns klar machen: Der Kindergottesdienst ist in einer Kirche, die für die Säuglingstaufe eintritt, "einer der klassischen Bausteine des Gemeindeaufbaus. Wer hier mit seinen Bemühungen um die Erneuerung der Gemeinde einsetzt, muß nicht erst völlig neue Strukturen neben die alten setzen, sondern kann Vorhandenes ausbauen." (Herbst, allerdings im Zusammenhang des KU) Es müssen keine neuen Wege sein, die der Kindergottesdienst einschlagen muss, um "zukunftsfähig" zu werden, bzw. zu bleiben. Vielmehr gilt es, die alten Wege beizubehalten, aber konsequent auf heutige Bedürfnisse auszubauen. Die Zeit der Kopfsteinpflaster ist vorbei. Nostalgie ist hier fehl am Platz! Wir brauchen einen neuen Belag auf alt-bewährtem Untergrund, um nicht zu sagen, Fundament! Mit diesem neuen, den modernen Bedürfnissen angepassten Belag, nimmt nach meiner Erfahrung der Verkehr auf dem Weg zum Kindergottesdienst auch wieder zu! Wo dieser Umbau aber im Kontext einer Konzeption für die gesamte Gemeindeaufbauarbeit vollzogen wird, wird dies auch Konsequenzen auf das innere und äußeres Wachstum der Gemeinde haben. Dabei sollte nicht die Nachhaltigkeit dessen außer Acht gelassen werden, was heute im Helferkreis und im Kindergottesdienst durch das Hören auf Gottes Wort selbst angestoßen und bewegt wird. Denn bei alledem muss mit allem Nachdruck unterschieden werden zwischen dem, was Menschen zum Aufbau einer Gemeinde beitragen können und dem, was unser auferstandener Herr Jesus Christus selbst damit bewirkt. Wir sind wie Johannes der Täufer Wegbereiter! Eingebunden in den Gemeindeaufbau unseres Herrn gilt auch hier das Wort aus Joh 15,5:
(Diese Ausführungen sind meiner Hausarbeit für das 2.theol. Examen entnommen. Sie stammen vom Juni 2003.)
Die letzte Änderung fand am 05.05.2004 statt. |